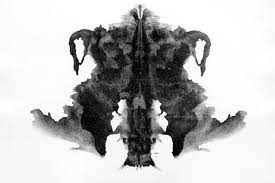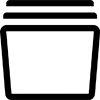Am 4.10. machte Bernhard Weingartner mit seinem Physikmobil halt bei uns am BORG Götzis. Mit einfachsten Alltagsmaterialien zeigte er uns, dass der Alltag voller physikalischer Phänomene steckt. Seine Experimente regten uns zum Staunen, Grübeln und manche von uns sogar zum Diskutieren an.
Wir bedanken uns bei Bernhard Weingartner für den unterhaltsamen Einblick in die spannende Welt der Physik. Bei der Initiative MINT Vorderland/ amKumma möchten wir uns für die Vermittlung dieser tollen Veranstaltung bedanken.
Am 4.10. machte aber nicht nur das Physikmobil halt am BORG Götzis, es wurde auch Geschichte geschrieben. Dem österreichischen Physiker Anton Zeilinger wurde an diesem Tag zusammen mit zwei weiteren Quantenforschern der Physiknobelpreis verliehen. Beide Anlässe haben mich dazu veranlasst meine Gedanken zu den Themen Wissenschaft, Schule und Gesellschaft in Form eines Textes zu rekapitulieren.
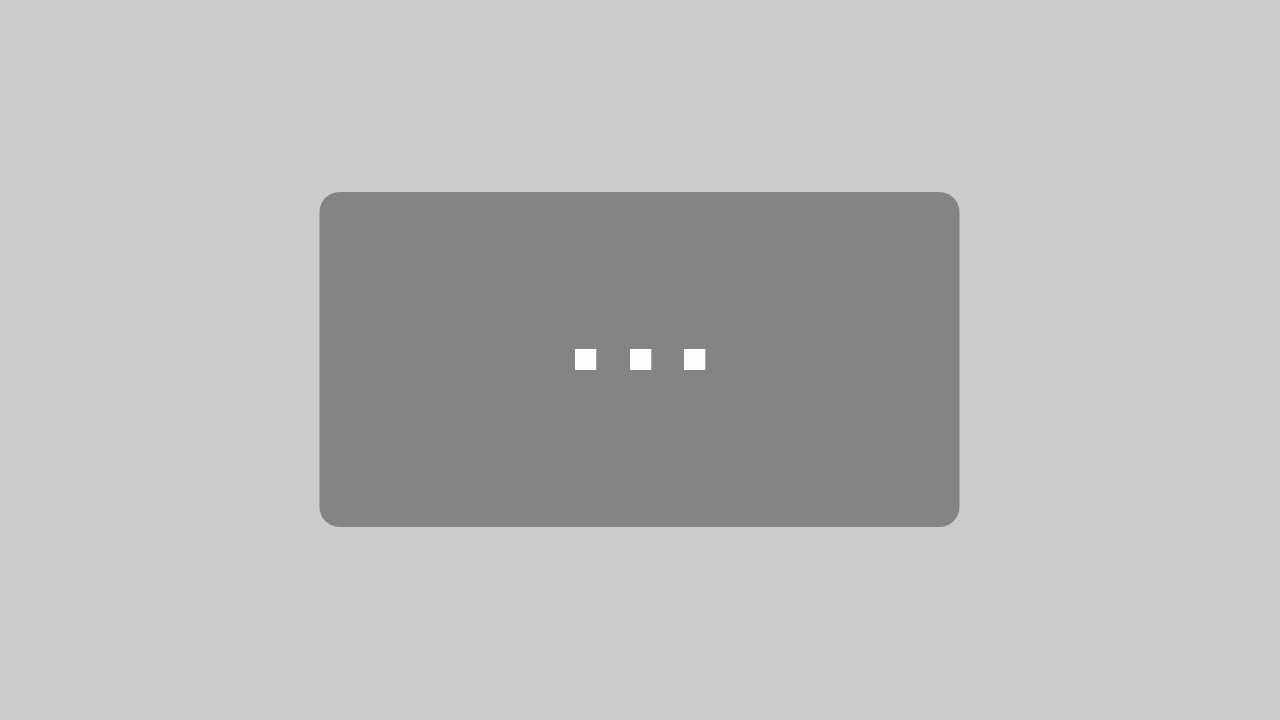
Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren